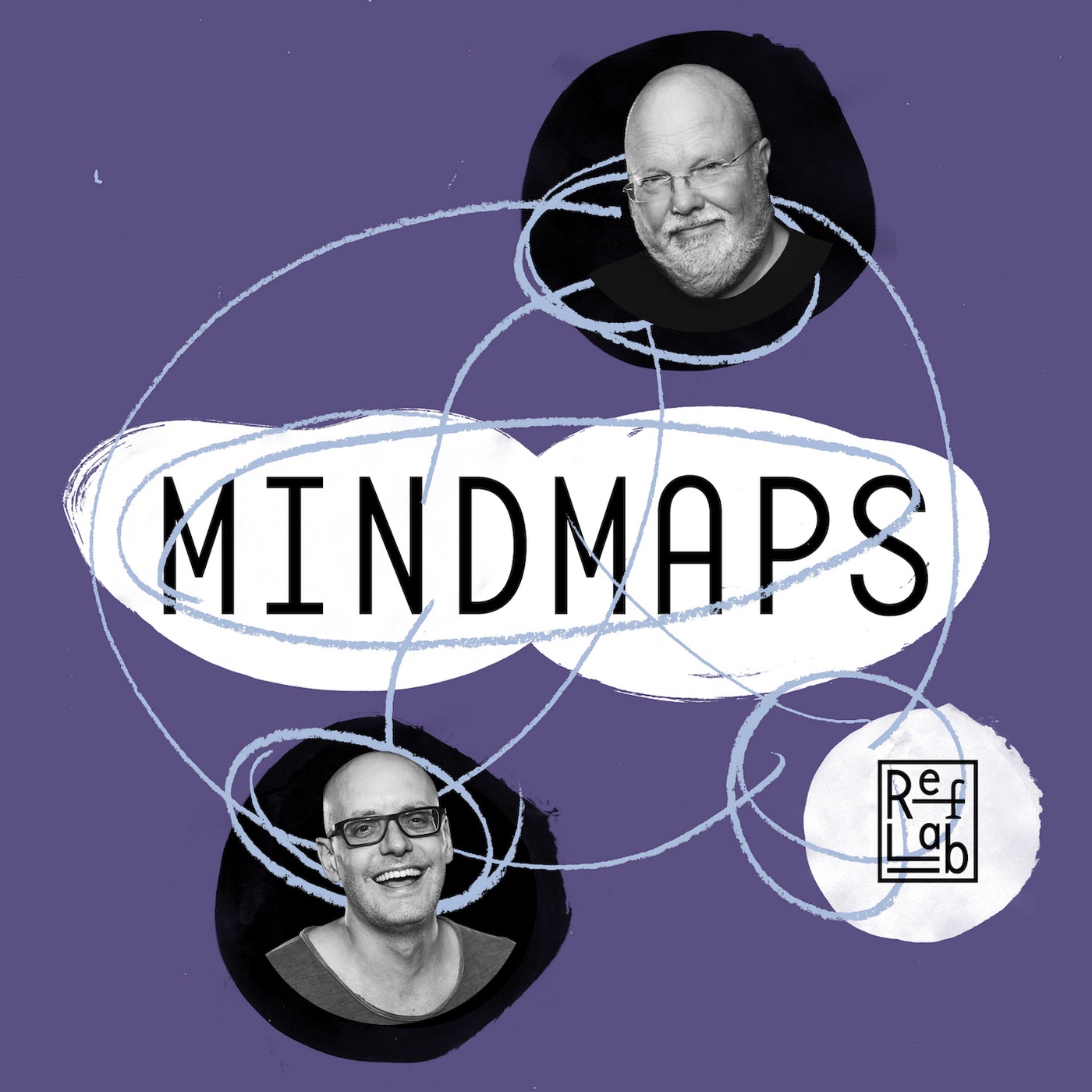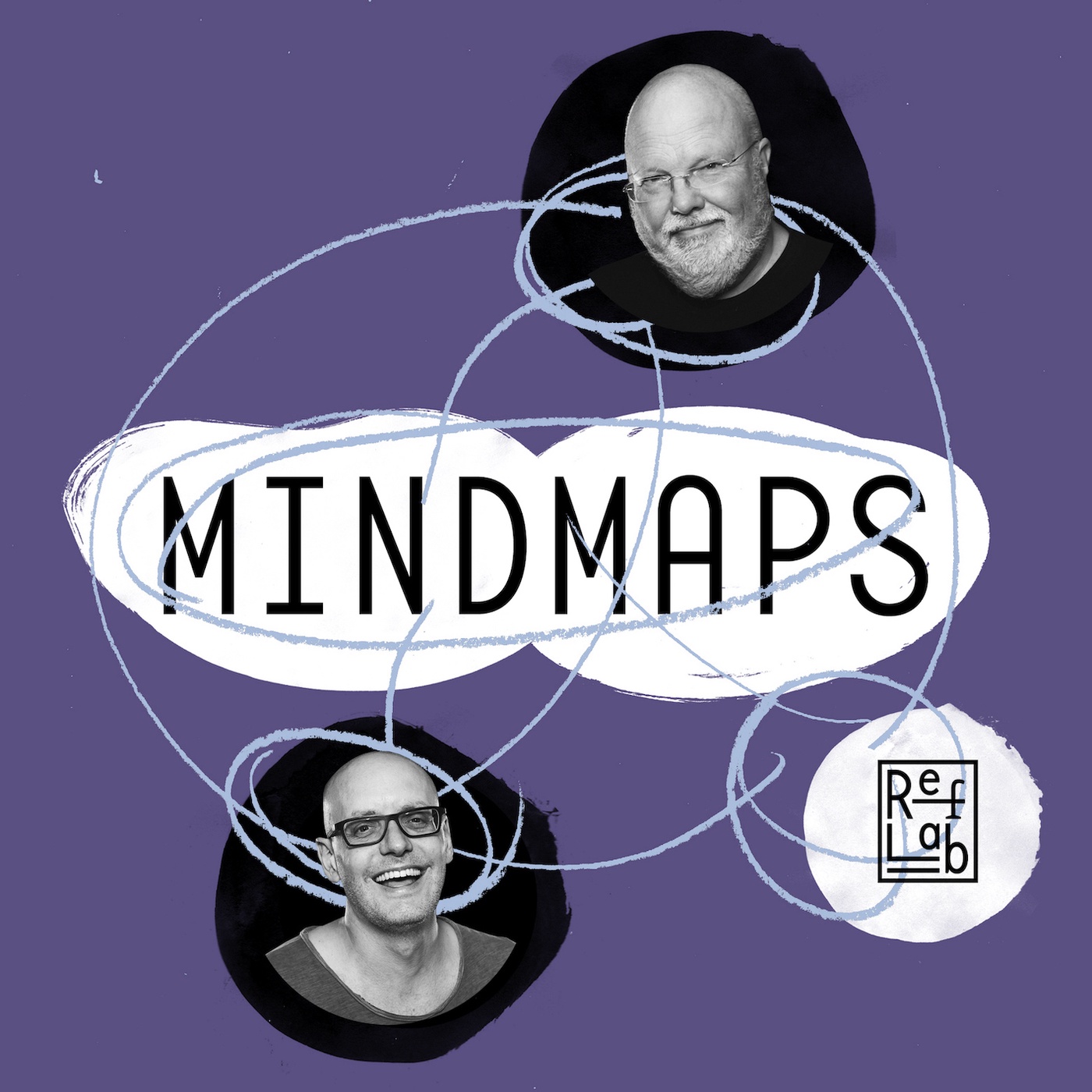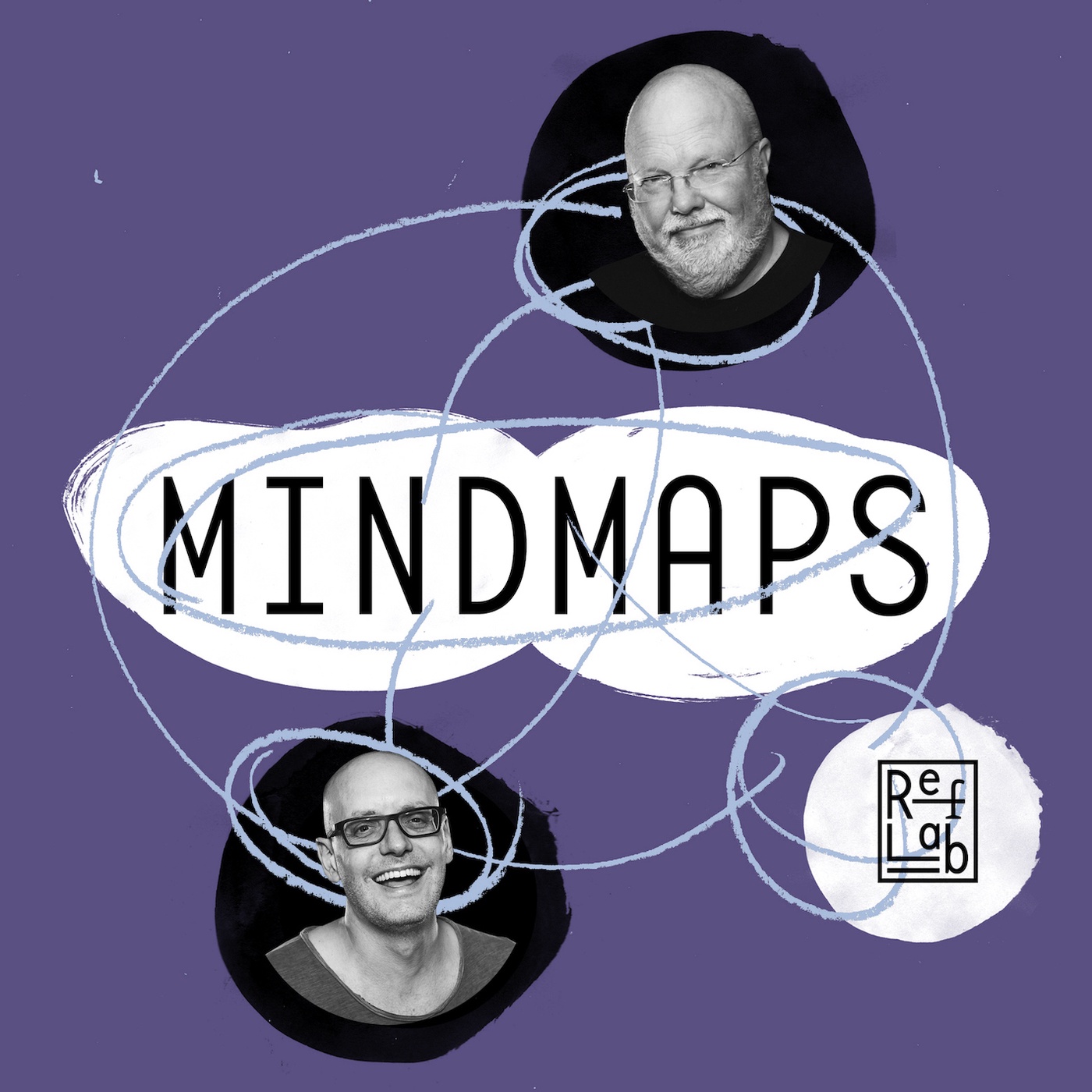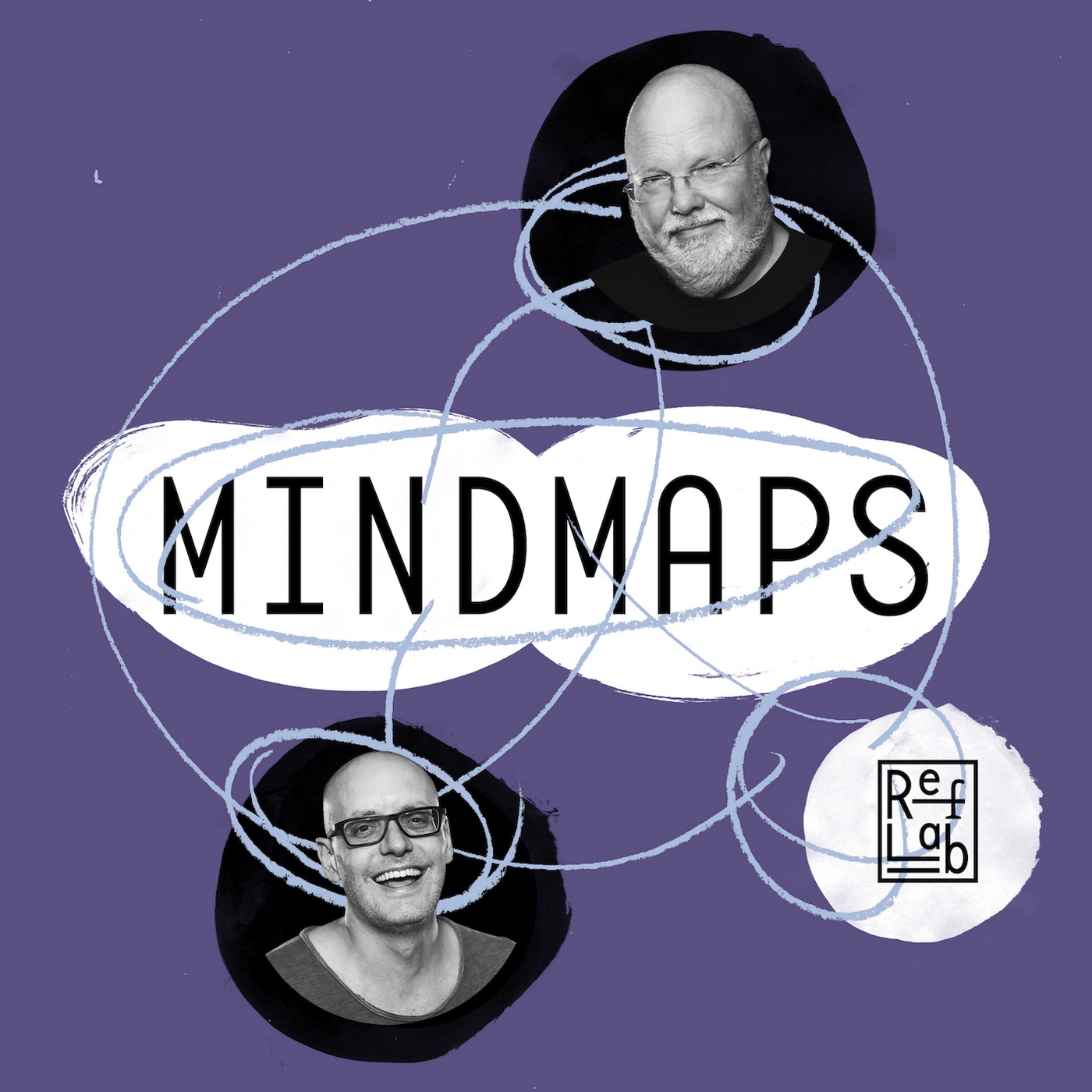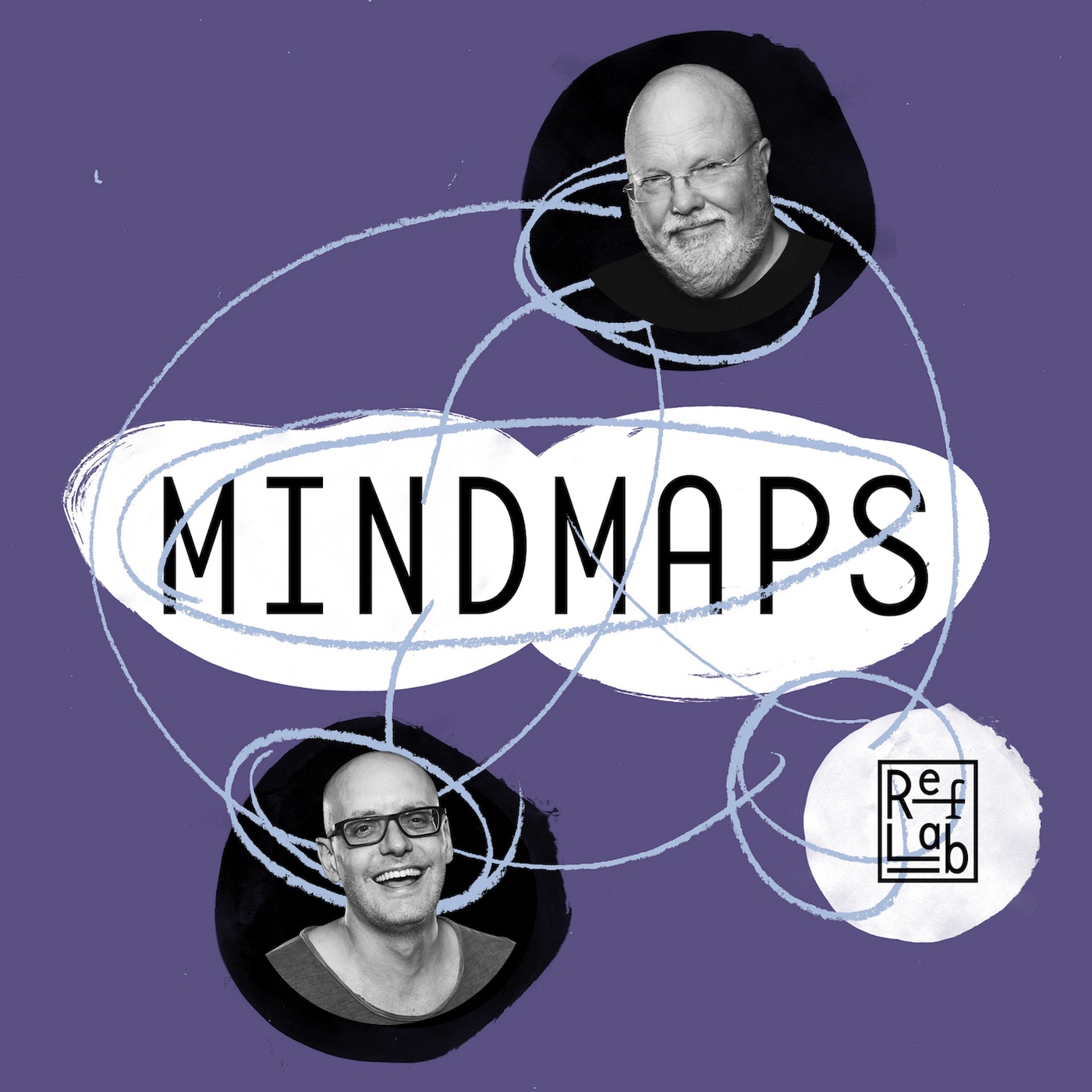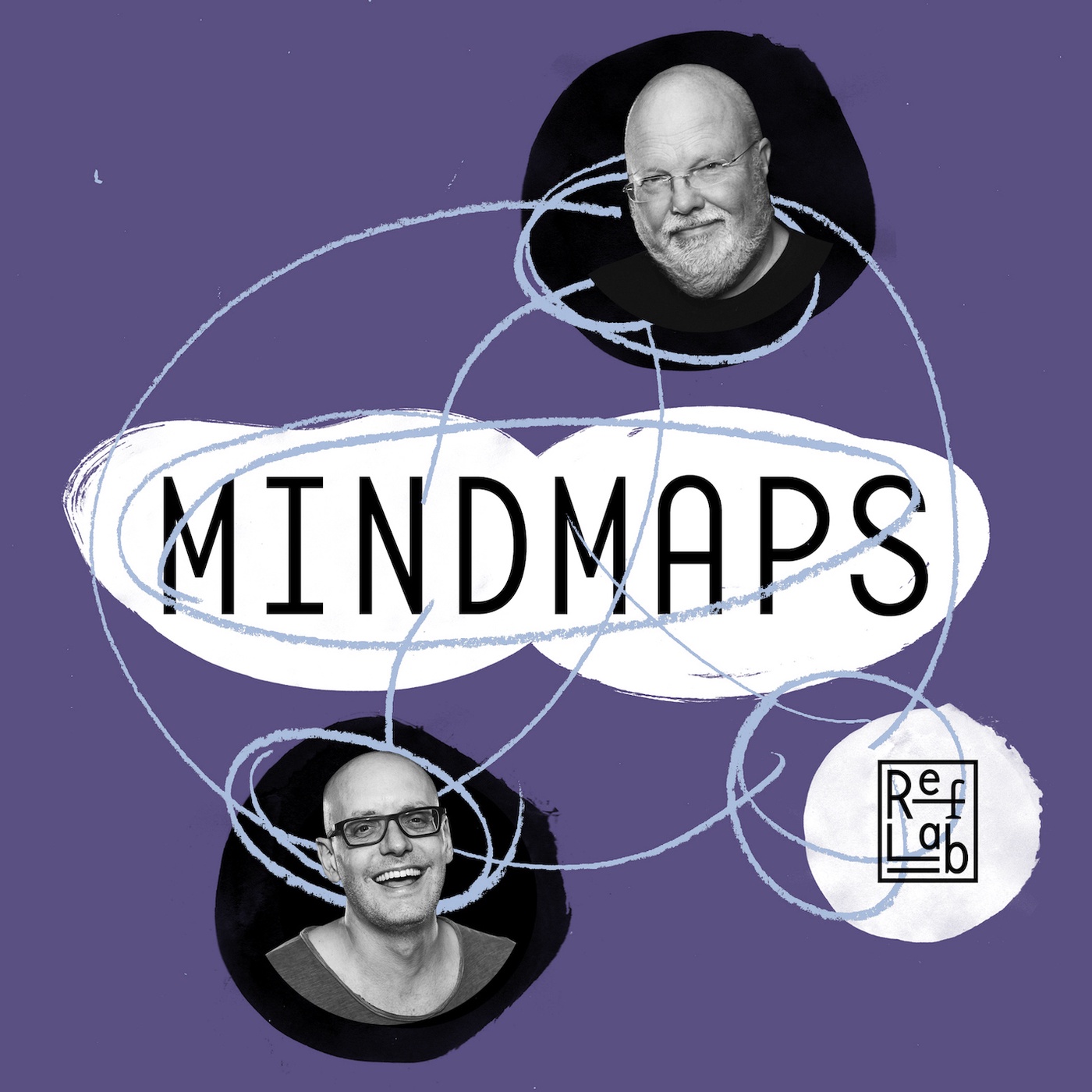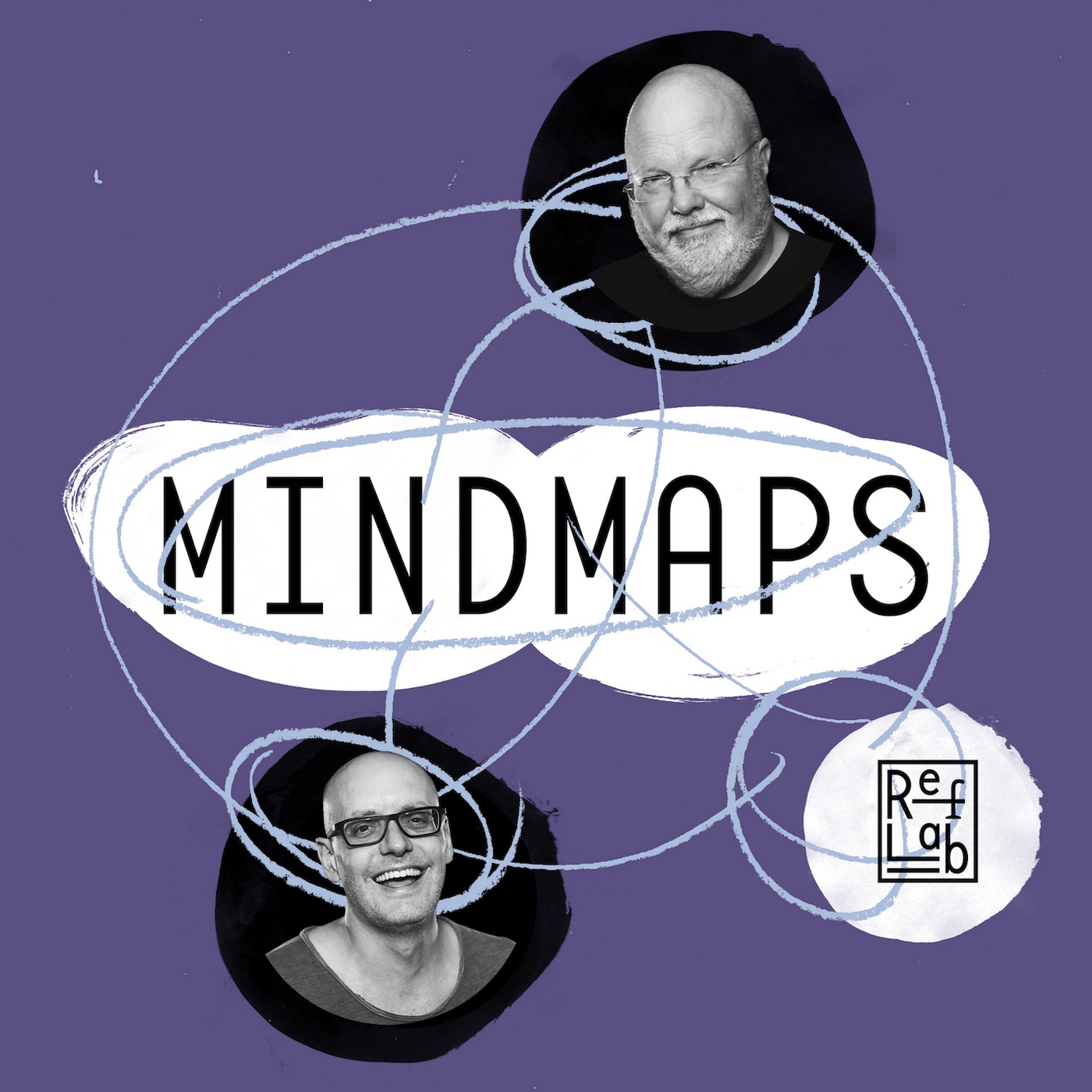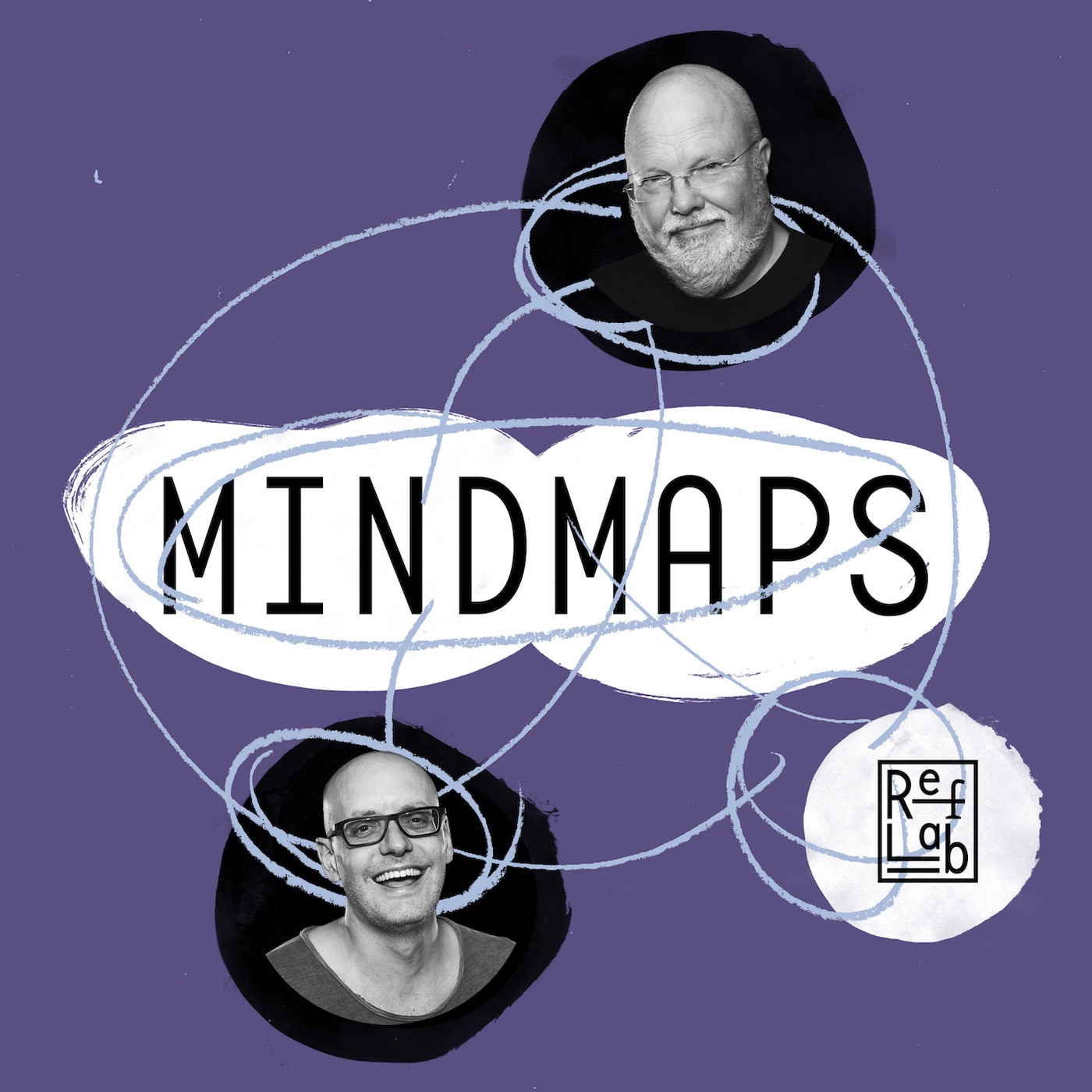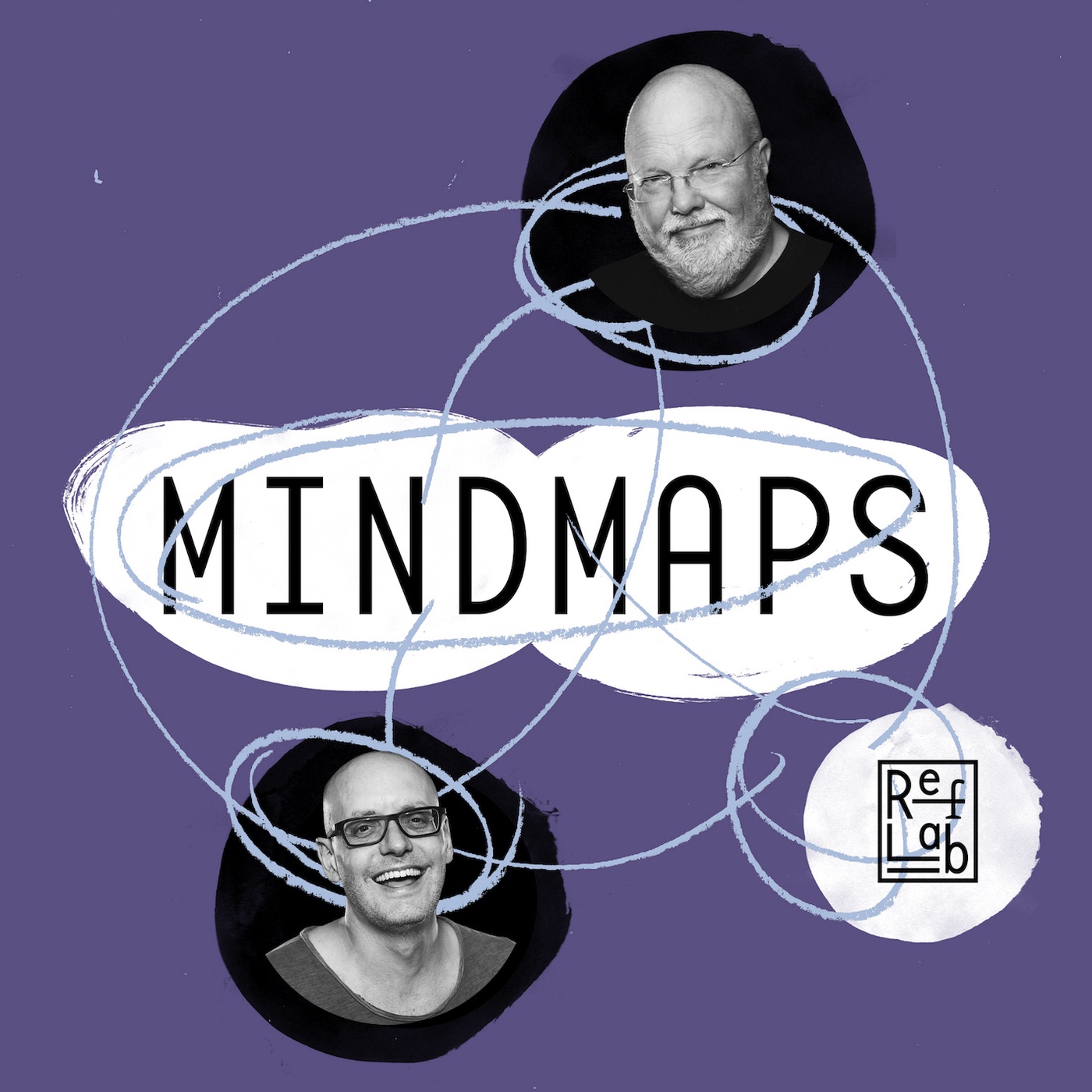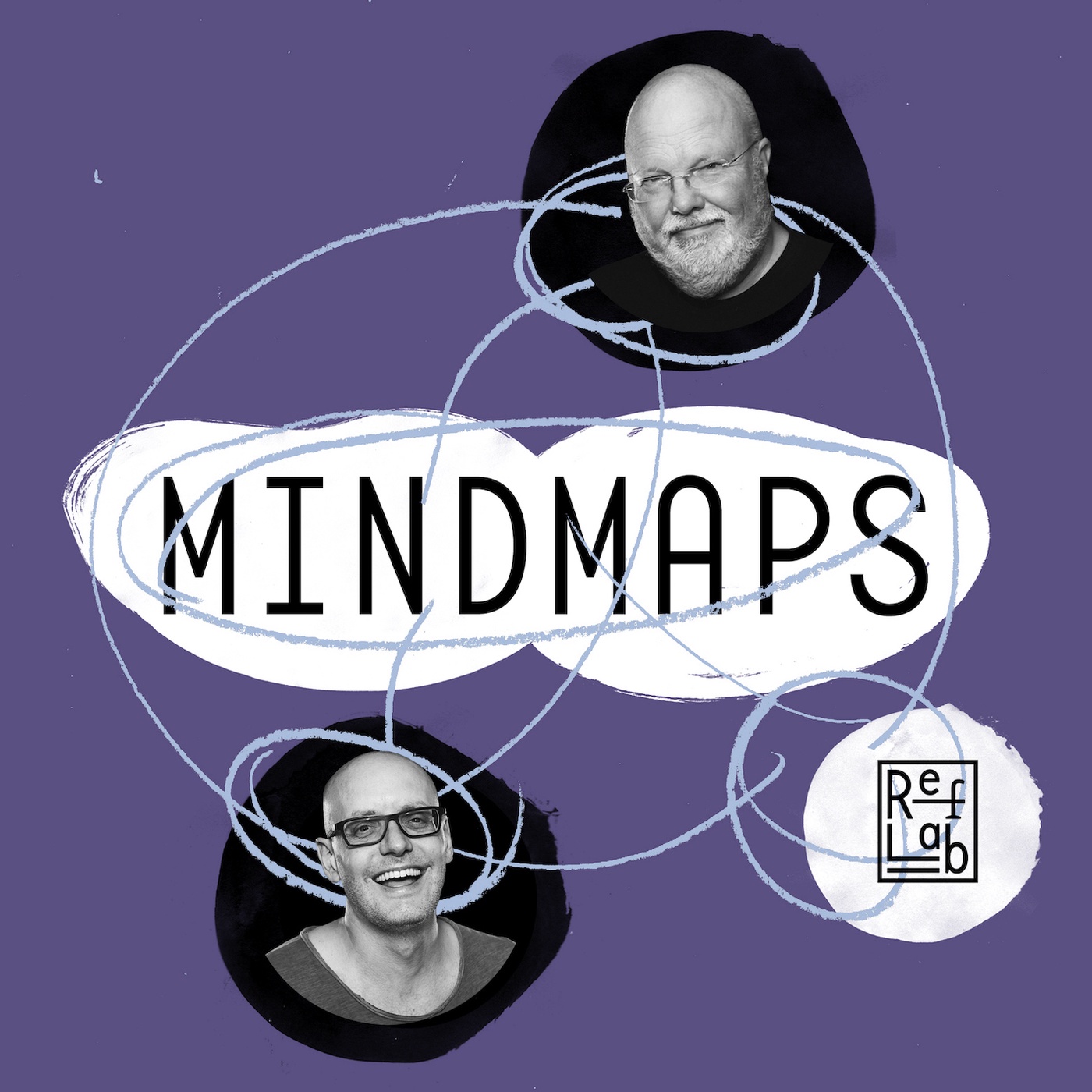
Gotthold Ephraim Lessing: Können sich die Religionen nicht endlich vertragen?
Der Aufklärungsphilosoph und Dichter Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) wurde nicht durch eine philosophische Abhandlung, sondern durch eine eingängige Erzählung weltberühmt: In «Nathan der Weise» plädiert er in narrativer Form für den Frieden der (monotheistischen) Religionen.
Peter und Manuel vertiefen sich in die sog. «Ringparabel», welche den argumentativen Kern des Erzählung Lessings bildet – und fragen sich, inwiefern deren Vorgaben als Modell zur Verständigung der Religionen taugt. Ist es wirklich so einfach: Sollten sich die Religionen einfach durch ihre ethischen Qualitäten bewahrheiten – oder wird hier unter der Hand die Eigenart und das Selbstverständnis der Religionen übersteuert? Wie aber könnte denn...