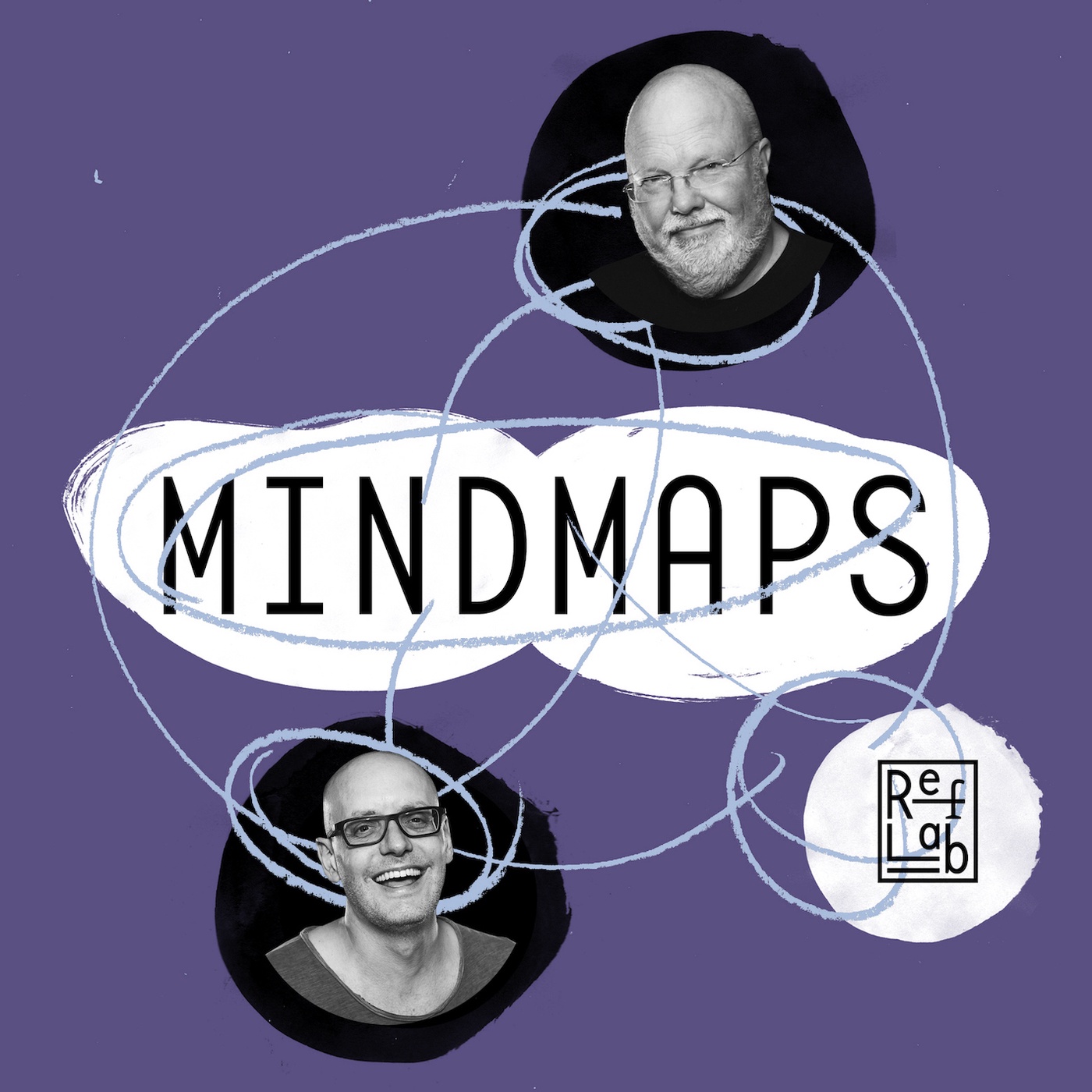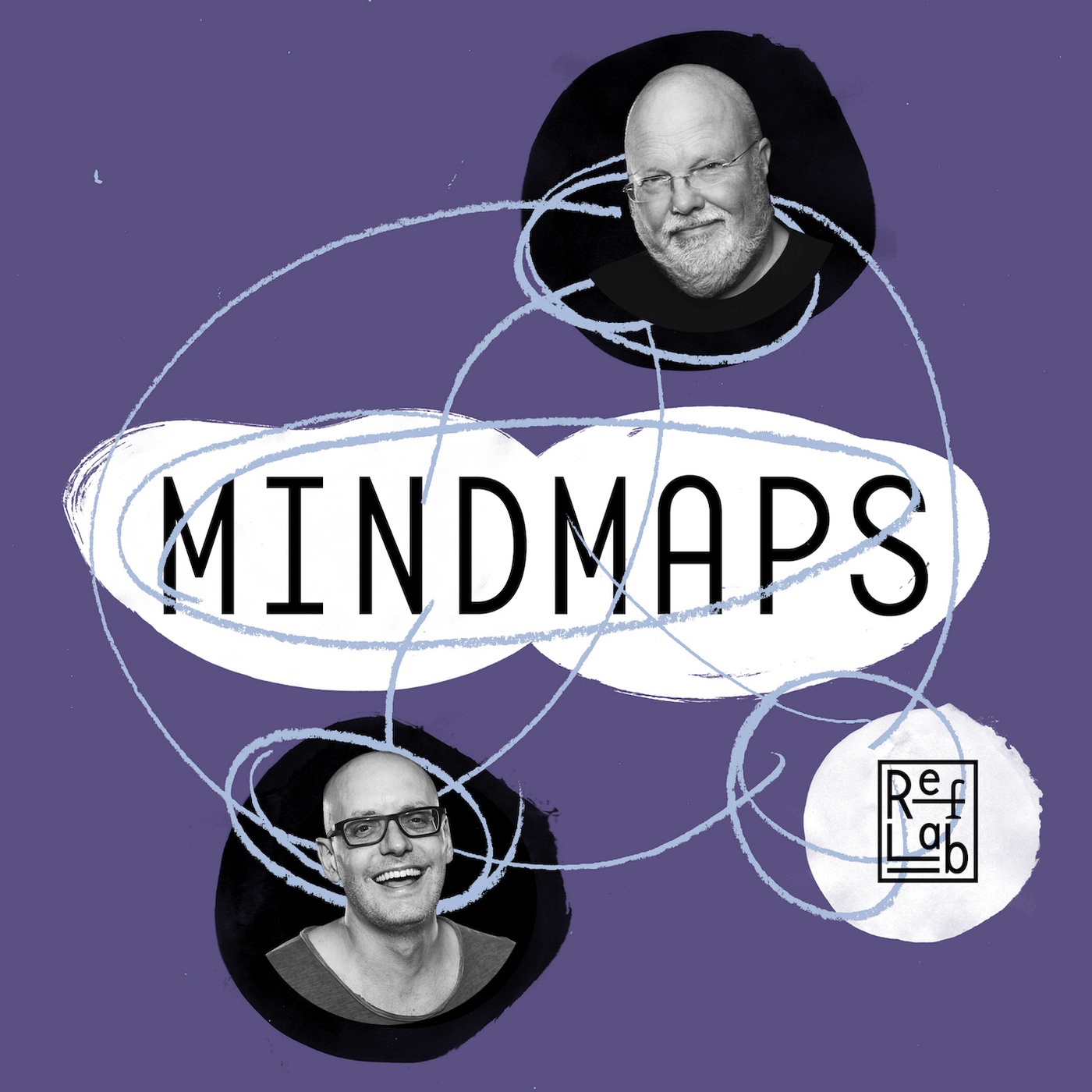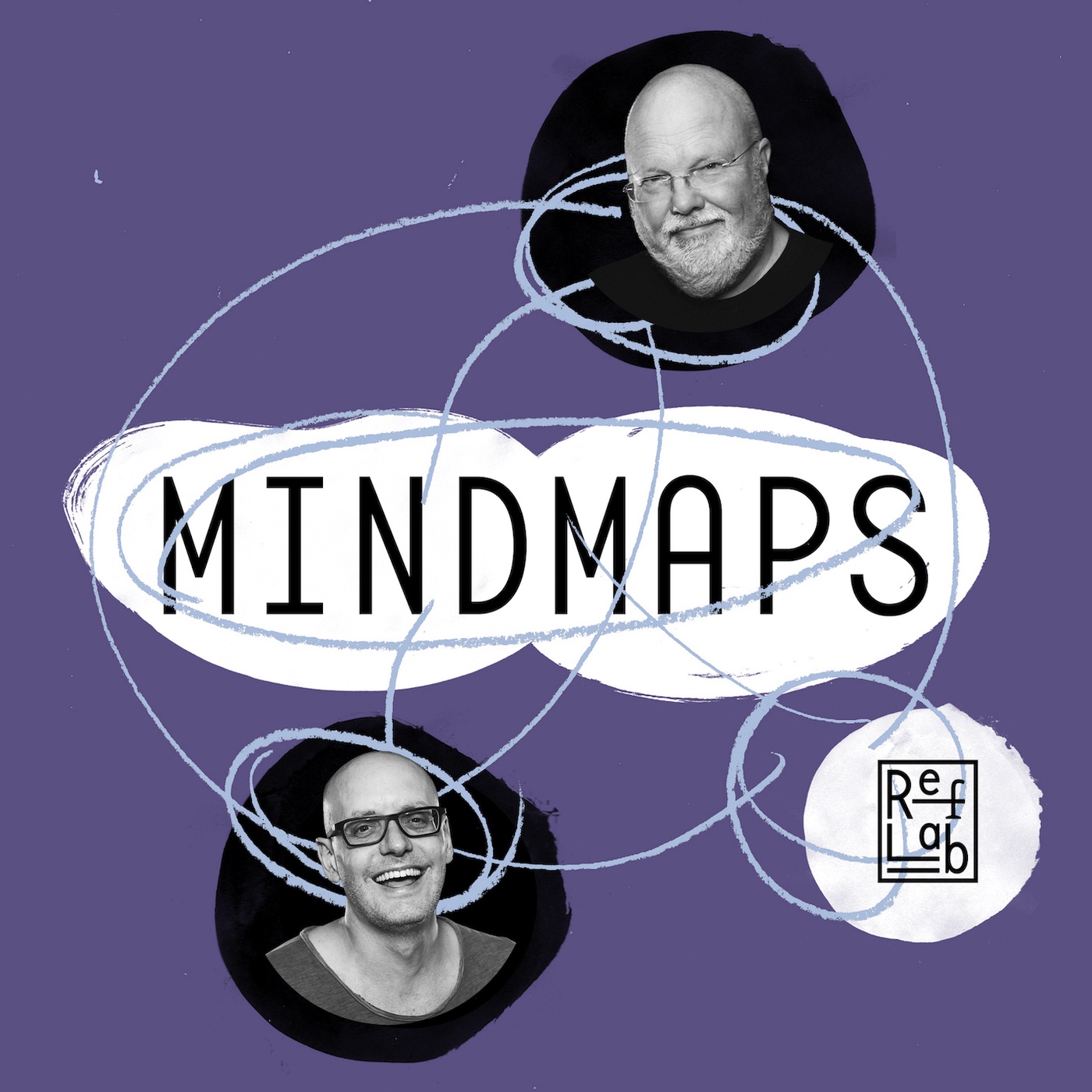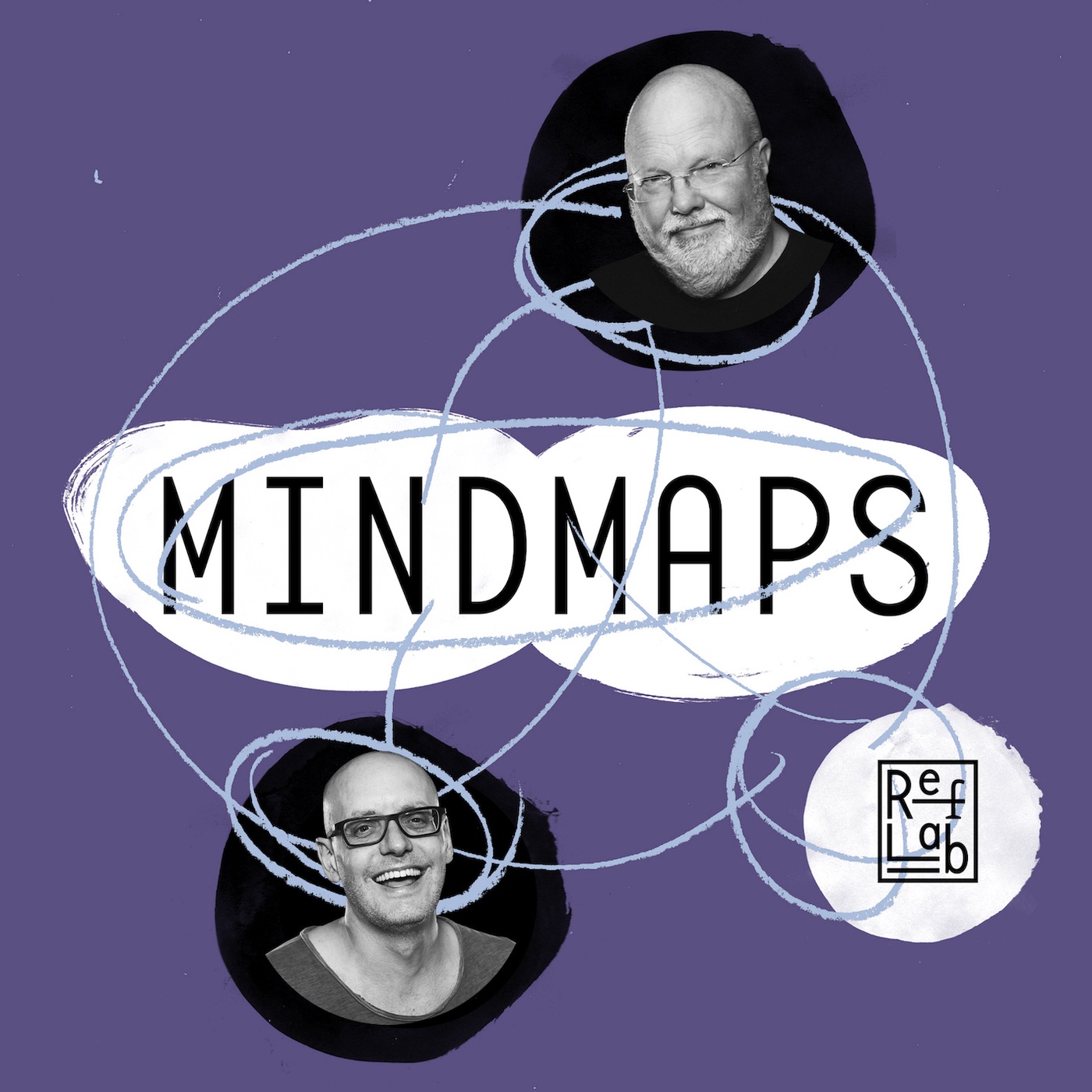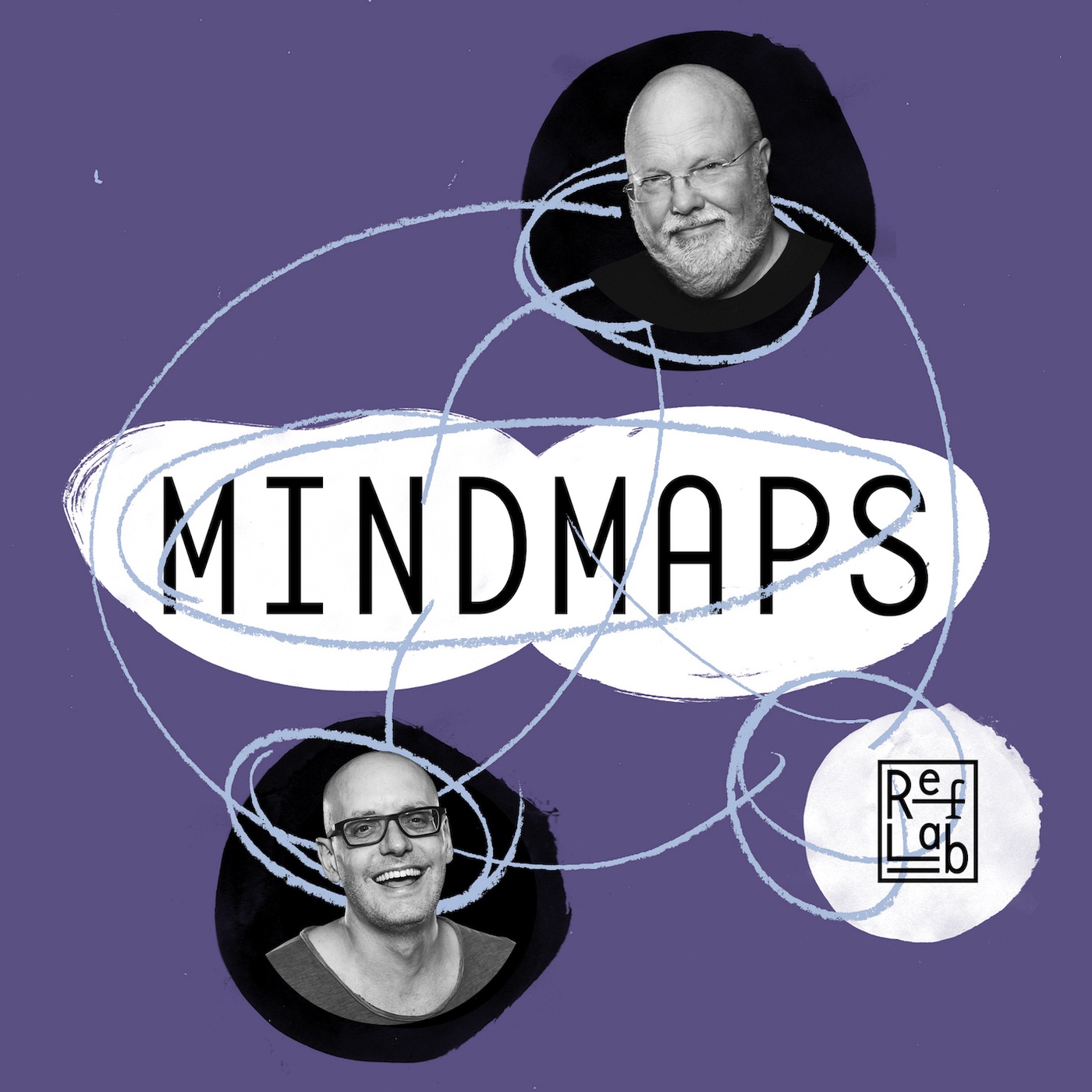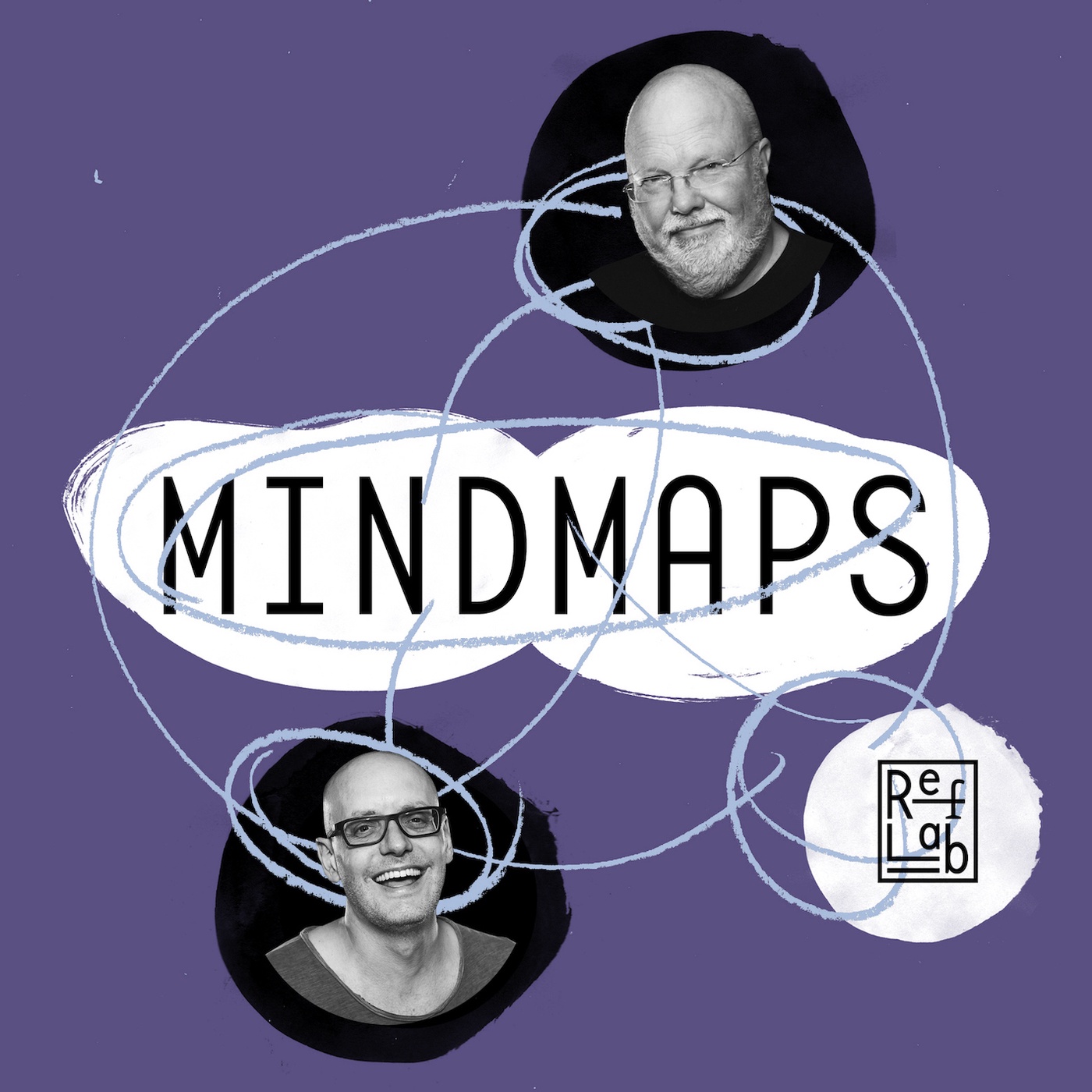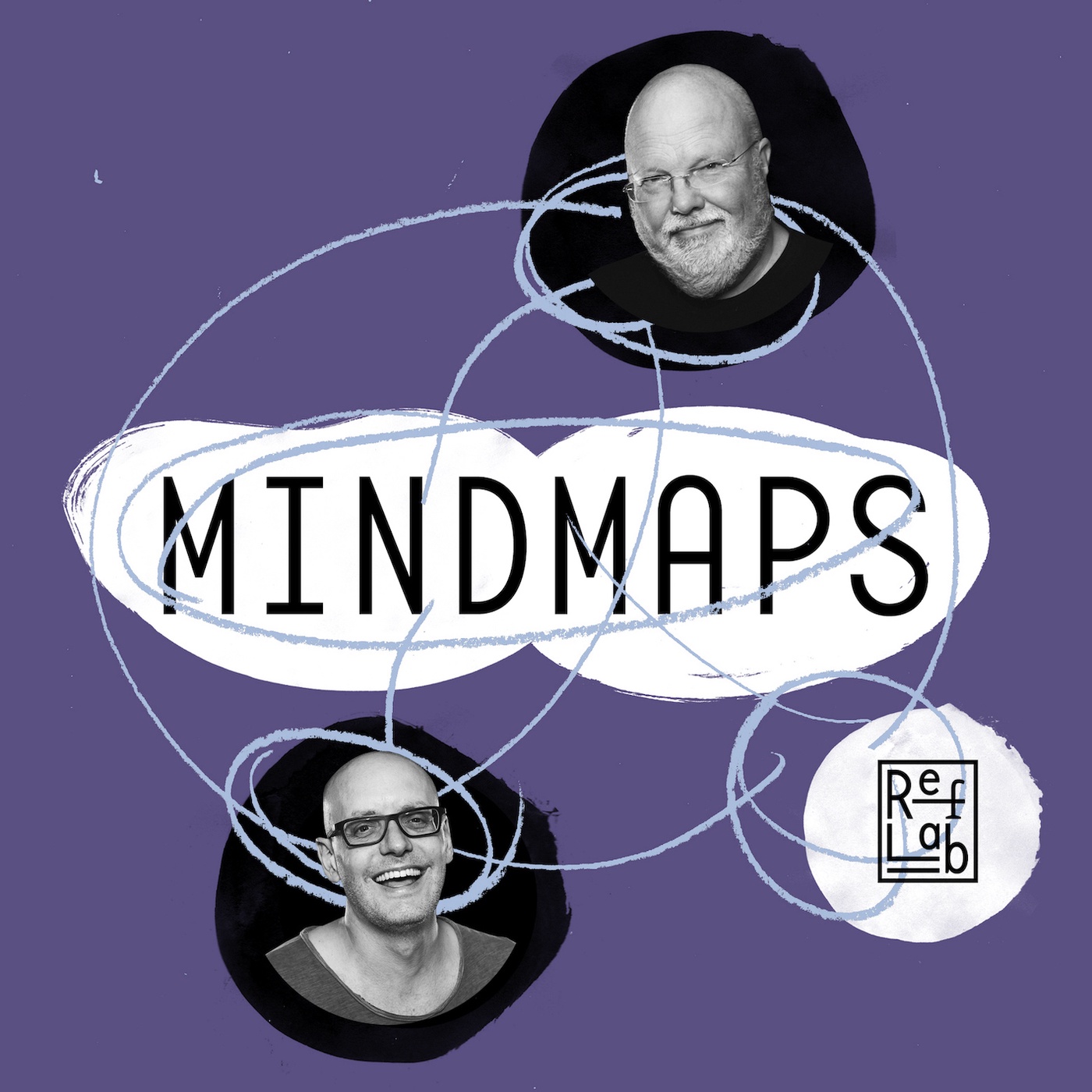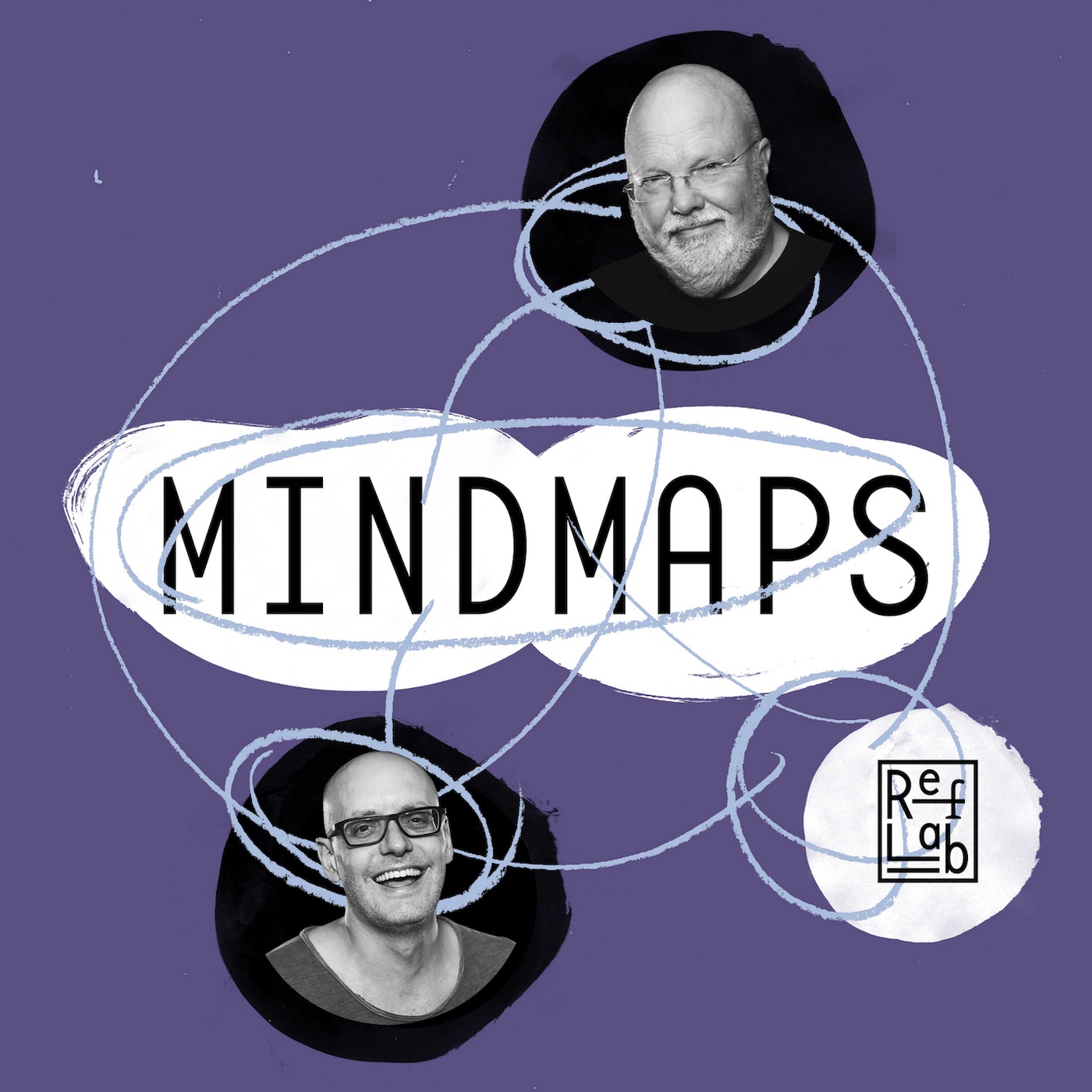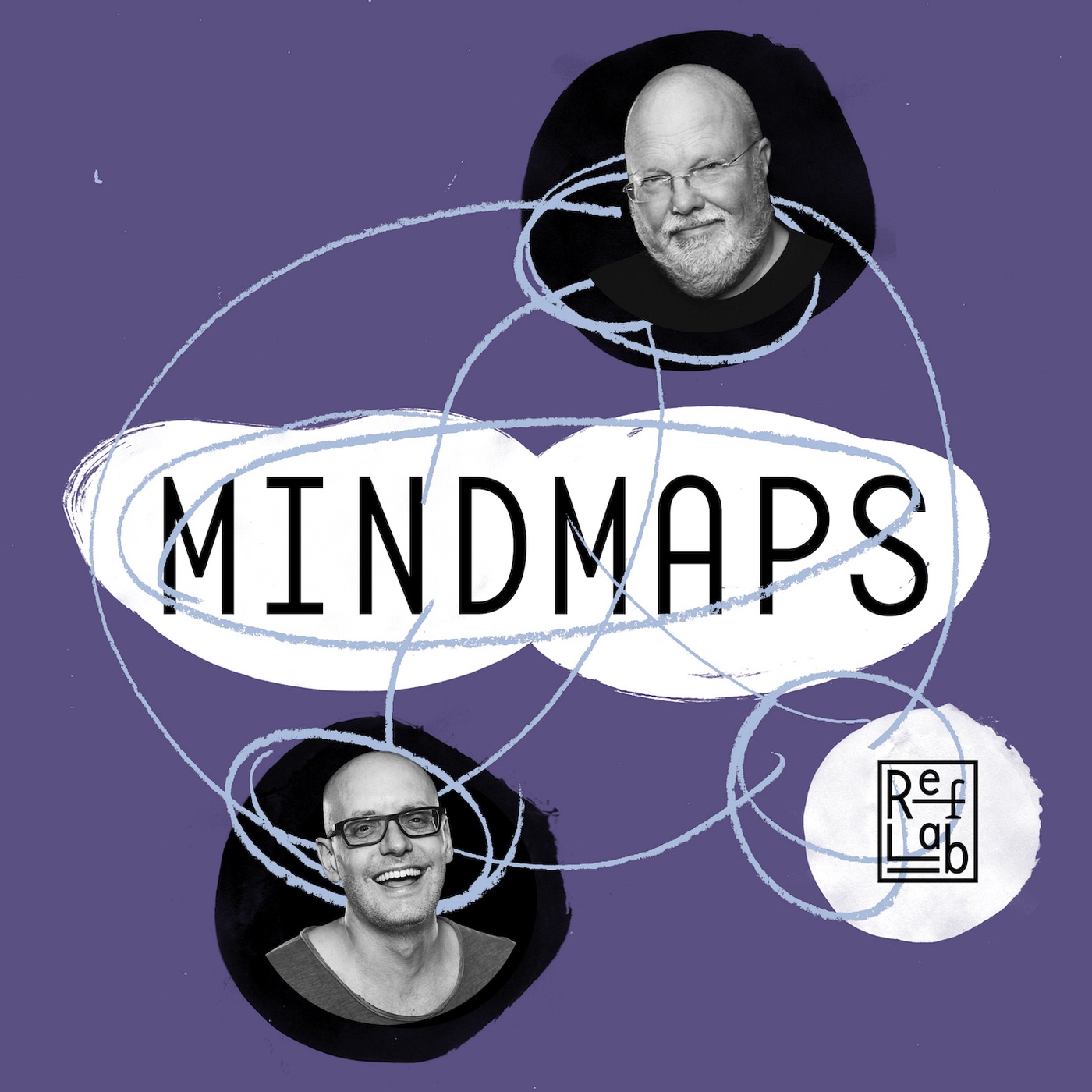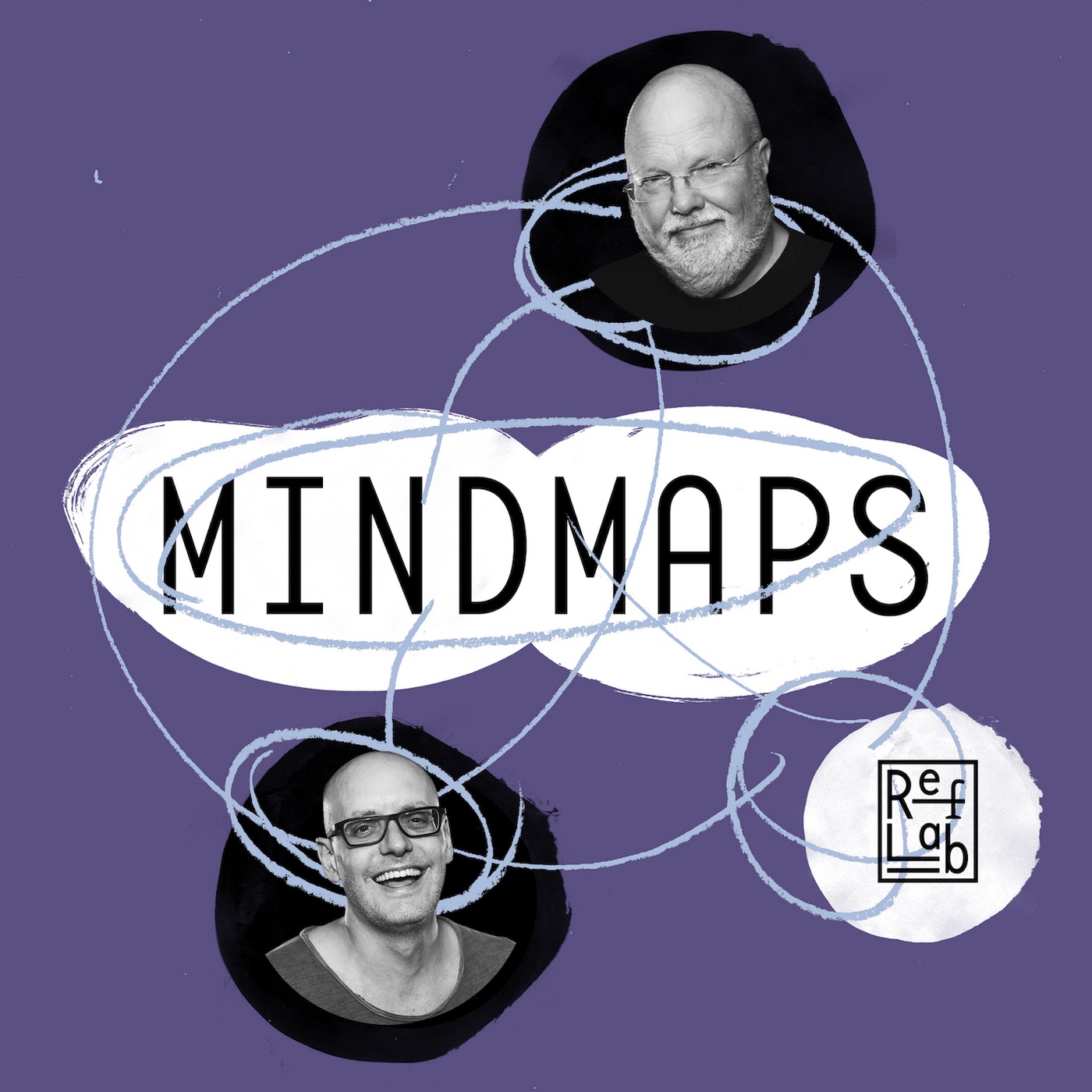
Special: Gibt es eine universale Moral? (Teil 2)
In diesem zweiten Teil des «mindmaps»-Specials zur Frage der Moralbegründung kommt zuerst der Shootingstar der deutschen Philosophieszene, Markus Gabriel, ausführlich zu Wort. Er vertritt ausgesprochen vollmundig einen «Moralischen Realismus» und ist überzeugt, dass die grundlegenden moralischen Werte, welche wir für tägliche Entscheidungen und das Zusammenleben der Menschen benötigen, völlig offensichtlich sind.
Im Gespräch von Manuel und Peter wird deutlich, wie dünn das Eis unter solchen Behauptungen ist – und wie stark sie von einem eurozentrischen, imperialistischen Impuls getragen sind, der einer kritischen Überprüfung nicht standhält. Es gibt eben – man könnte seufzend anfügen: leider! – keine universalen moralischen Gesetze, welche...